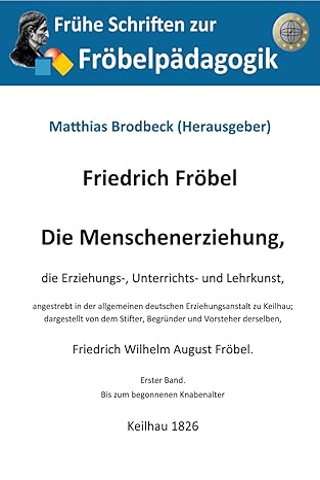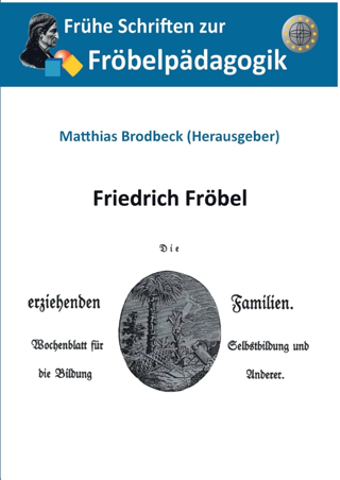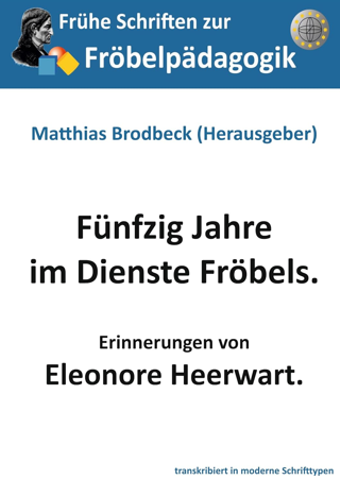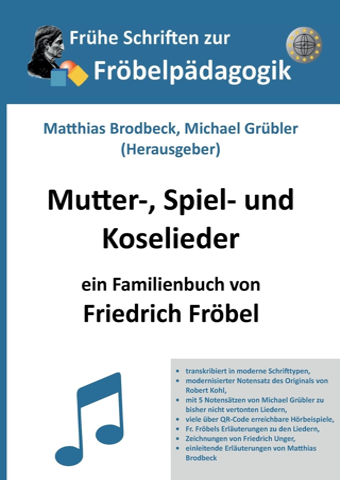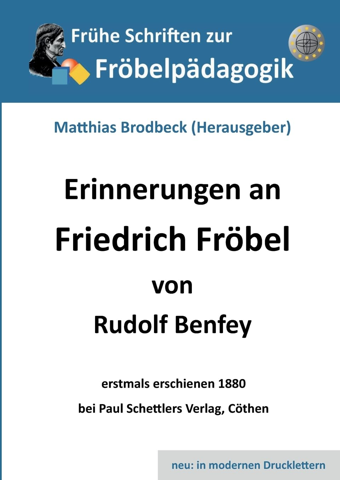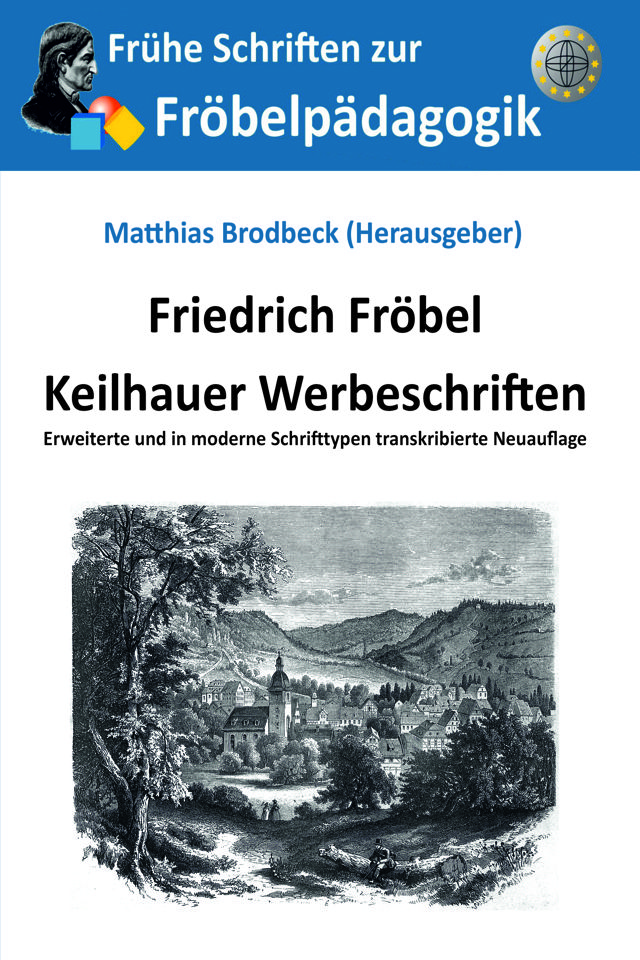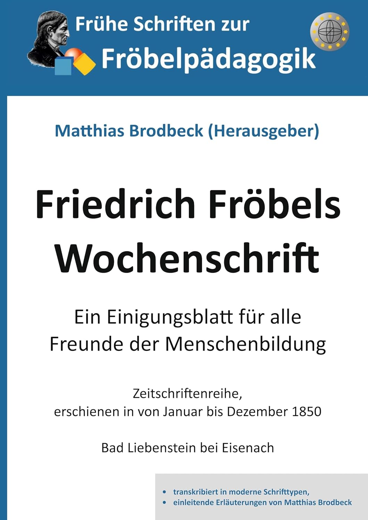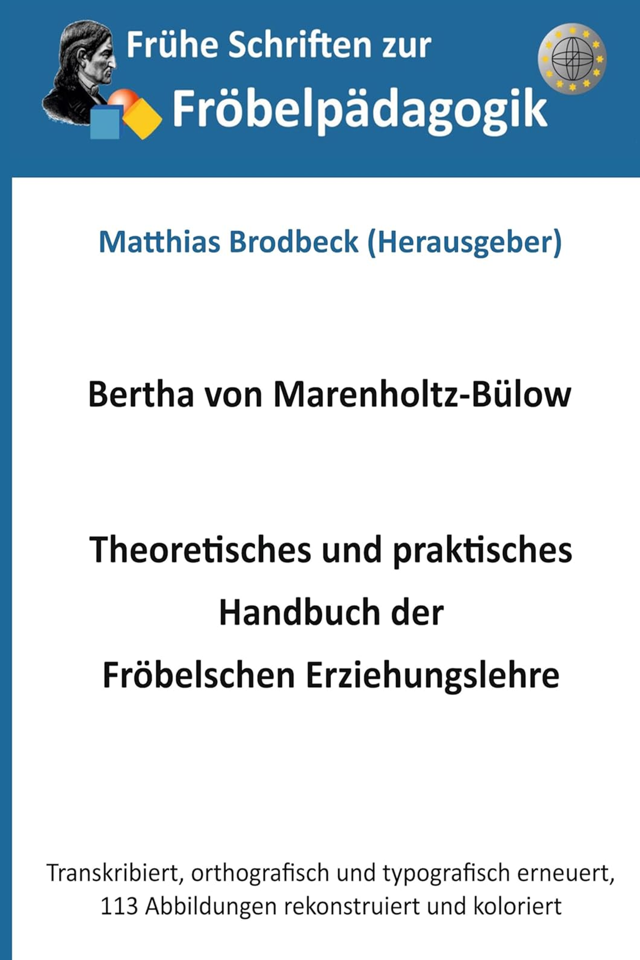In modernen Schrifttypen neu aufgelegt ...
Der Erziehungswissenschaftler Michael Winkler sah sich 2010 zu der bemerkenswerten Feststellung veranlasst, dass Fröbel nicht zeitgemäß sei:
[...] nicht, weil er dem Denken und der Sprache des beginnenden 19. Jahrhunderts verhaftet blieb. [...] vielmehr [...], weil er unserem gegenwärtigen pädagogischen Denken voraus ist, [...] Was er erkannt und verstanden hat, vor allem: wie er versucht hat, für die Komplexität vorrangig der kindlichen [...] Entwicklung [...] eine angemessene theoretische Sprache, zureichende Begriffe und eine sinnvolle Praxis zu entwickeln, das geht kaum zusammen mit dem, was gegenwärtig als Pädagogik diskutiert wird. [...]
Winkler, Michael: Der politische und sozialpädagogische Fröbel. In: Karl Neumann, Ulf Sauerbrey, Michael Winkler {Hrsg.): Fröbelpädagogik im Kontext der Moderne - Bildung, Erziehung und soziales Handeln - edition Paideia, Jena 2010, S. 28ff.
Allenthalben ist ein anwachsendes Interesse an Friedrich Fröbel, seinen Ideen und seinem Wirken zu spüren. Dies wurde sicherlich auch von Veröffentlichungen wie Norman Brostermans „Inventing Kindergarten" und Mitchel Resnicks „Lifelong Kindergarten" inspiriert.
Wir haben uns darum entschlossen, im Vorfeld des 175. Todestages Friedrich Fröbels (2027) sowie seines 250. Geburtstages (2032) den Interessenten von heute den Zugang zu Werken Fröbels, seiner Mitstreiter, Zeitgenossen und unmittelbaren Nachfolger zu erleichtern, indem wir die nur noch schwer erhältlichen und noch dazu nur in Frakturschrift zugänglichen Werke der Fröbelzeit und der ersten Jahrzehnte danach in zeitgemäß rezipierbare Buchform bringen.
Die Transkription aus der Frakturschrift in zeitgemäßen Schriftsatz erfolgte jeweils unter weitestgehender Anpassung an die orthografischen Regeln, die zum Bearbeitungszeitpunkt Gültigkeit hatten. Ausnahmen bilden Archaismen sowie Friedrich Fröbel zuzuschreibende Wortschöpfungen. Der Satzbau blieb unverändert.
Sukzessive erfolgen bis voraussichtlich 2032 weitere Veröffentlichungen von Werken Fröbels, seiner Zeitgenossen und seiner Nachfolger.
Matthias Brodbeck
(Herausgeber)


- An unser deutsches Volk (1820),
- Durchgreifende, dem deutschen Charakter erschöpfend genügende Erziehung ist das Grund- und Quellbedürfnis des deutschen Volkes (1821),
- Grundsätze, Zweck und inneres Leben der allgemeinen deutschen Erziehungsanstalt in Keilhau (1821),
- Die allgemeine deutsche Erziehungsanstalt in Keilhau betreffend (1822),
- Über deutsche Erziehung überhaupt und über das allgemeine Deutsche der Erziehungsanstalt in Keilhau insbesondere (1822) sowie in Erweiterung dieser seinen Briefwechsel mit dem Philosophen Karl Christian Friedrich Krause:
- Karl Christian Friedrich Krause: Einige Bemerkungen zu Fröbels Abhandlung (1823)
- Friedrich Fröbel – Brief an Karl Christian Friedrich Krause (autobiografischer Brief; Keilhau, 24. Mai / 2. Juni / 17. Juni 1828),
- Fortgesetzte Nachricht von der Allgemeinen Deutschen Erziehungsanstalt in Keilhau (1823),
den Visitationsbericht des Superintendenten Christian Zeh von 1825:
- Bericht über die Fröbelsche Erziehungsanstalt zu Keilhau. (Superintendent Christian Zeh, 1825),
und Dokumente zum visionären Helba-Plan:
- Anzeige der Volkserziehungsanstalt in Helba, unweit Meiningen (Friedrich Fröbel, 1829).
- typografisch und orthografisch erneuert (Wortlaut originalgetreu beibehalten)
- beide Bücher in einem Band zusammengeführt
- Bildtafeln grundlegend überarbeitet und coloriert